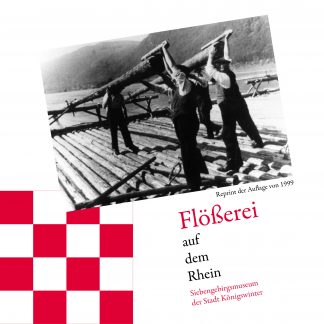Beschreibung
Vorwort zur 2. Auflage von Dr. Mario Marsch 2014
Wenn sich der Sächsische Forstverein und der Autor, Prof. Dr. Dr. Thomasius, im „Nachhaltigkeitsjahr“ entscheiden, eine Neuauflage einer Broschüre zum Einfluss des Bergbaus auf Wald und Forstwirtschaft im sächsischen Erzgebirge auf den Weg zu bringen, kann man das durchaus symbolisch verstehen.
Bei den zahlreichen Veranstaltungen zum 300. Jahrestag der Herausgabe des Carlowitz-Werkes „Sylvicultura Oeconomica“ mit seiner „ continuierlichen, beständigen und nachhaltenden Nutzung“ haben sich viele gefragt: Warum gerade in Sachsen und warum im Umfeld des Bergbaus? Nun, die Antwort ist einfach: Nachhaltigkeit ist in erster Linie ein Ergebnis des Mangels, der Knappheit von Gütern – in diesem Fall an Holz. Bergbau und Hüttenwesen, die letztlich den Reichtum von Sachsen ausmachten, wären ohne Holz, sehr viel Holz und andere Forstprodukte nicht entwicklungsfähig gewesen.
„Hat Gott ein Land mit Ertzen und Mineralien gesegnet, so ist es unmöglich ohne Holtz und zwar in ziemlicher Menge desselben, solche gut zumachen“ (Carlowitz 1713)
In kaum einer anderen Region war diese Wechselbeziehung so eng wie hier. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern wollte man mit dem Problem aber nicht „nachlässig“, sondern „nachhaltig“ – in Verantwortung für kommende Generationen – umgehen. (selbst wenn sich die sächsischen Wälder im 18. Jahrhundert in einem erbärmlichen Zustand befanden)
Schon die erste sächsische Forstordnung aus dem Jahre 1560 von Kurfürst August von Sachsen fordert, dass „…die Wald- und Holznutzung auch eine vor und vor gleich wehrende Nutzung bleiben könnte und möge…“ – auch so kann man das Nachhaltigkeitsprinzip formulieren, auch hier im Zusammenhang mit Bergbau, Waldankäufen, Vermessung – und Vermögenssicherung für die Zukunft.
Es gibt in beiden Fällen etwas Gemeinsames, das, was letztlich Nachhaltigkeit im Kern ausmacht: Die Generation, die in Verantwortung für Mensch und Natur Dinge zum Positiven verändern will, gehört nicht derselben Generation an, wie die, die in Zukunft den Nutzen davon haben wird.
Wenn wir über Dauerhaftigkeit und Beständigkeit sprechen, dann auch im Zusammenhang mit der Neuauflage dieser Broschüre, die nach fast 20 Jahren nichts an Aussagekraft und Aktualität eingebüßt hat. Diese 2. überarbeitete und in Wort und Bild erweiterte Auflage wird sicherlich wieder zahlreiche Interessenten, nicht nur im forstlichen Bereich, sondern weit darüber hinaus finden. Prof. Dr. Dr. Thomasius gelingt es darin in vortrefflicher Weise am Beispiel des sächsischen Erzgebirges den großen Bogen von der natürlichen Vegetation, den drei Rodungsperioden, der Art der Waldnutzung und dem Holztransport bis hin zu den Anforderungen des Bergbaus und der ambivalenten Beziehung zwischen Bergbau und Forstwirtschaft zu schlagen und letztlich einen Ausblick auf die rationelle Forstwirtschaft des 18. und 19. Jahrhunderts zu geben. Die vorliegende Broschüre gehört damit sicherlich zu den Standardwerken mitteleuropäischer Wald- und Forstgeschichte.
Dabei gebührt dem Autor besondere Anerkennung, ein spannendes und durchaus vielschichtiges Thema in aller Prägnanz und Klarheit, und unter Bezug auf primäre Quellen für uns aufbereitet zu haben.
So widersprüchlich es auch erscheinen mag: Bergbau ist der Verursacher des Holzmangels und bildet doch den Ursprung einer planmäßigen Forstwirtschaft. Die Entwicklung der Montanwissenschaften führte zur Entstehung der Forstwissenschaften und prägte unsere heutige Sicht auf eine nachhaltige Entwicklung. Vielleicht kann man so die Botschaft dieser Broschüre im „Nachhaltigkeitsjahr“ zusammenfassen.
Über die Jahrhunderte hinweg hat der Begriff „Nachhaltigkeit“ einen steten Wandel erfahren – in der heutigen Mediengesellschaft schon fast zur Beliebigkeit. Nachhaltig sind nicht nur die Landnutzung und die Finanzpolitik, sondern auch das Konsumverhalten, die Medienpräsens und sogar der Bergbau selbst. Hier sind wir als Forstleute gefordert. Auch wir haben Nachhaltigkeit weder erfunden, noch entdeckt; selbst die Idee ist seit biblischen Zeiten bekannt. Hier nur die Deutungshoheit für sich zu proklamieren reicht bei weitem nicht mehr aus. Aber gerade unsere Kenntnis der Wald- und Forstgeschichte ist identitätsbildend und prägt unser wirtschaftliches Handeln seit Jahrhunderten. Das berechtigt uns die ethischen, ökologischen und unternehmerischen Facetten der Nachhaltigkeit in der politischen und medialen Diskussion unter dem Blickwinkel eines zukunftssichernden Handelns stärker als bisher mit zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Freude beim Lesen und Verstehen unserer so vielfältigen, fast tausendjährigen Bergbau- und Forstgeschichte. Mögen Sie dabei auch für Ihr eigenes, „nachhaltiges“ Handels historisch gegründete Inspirationen erfahren.
Dr. Mario Marsch
Vorsitzender des Sächsischen Forstvereins,
Tharandt im Dezember 2013