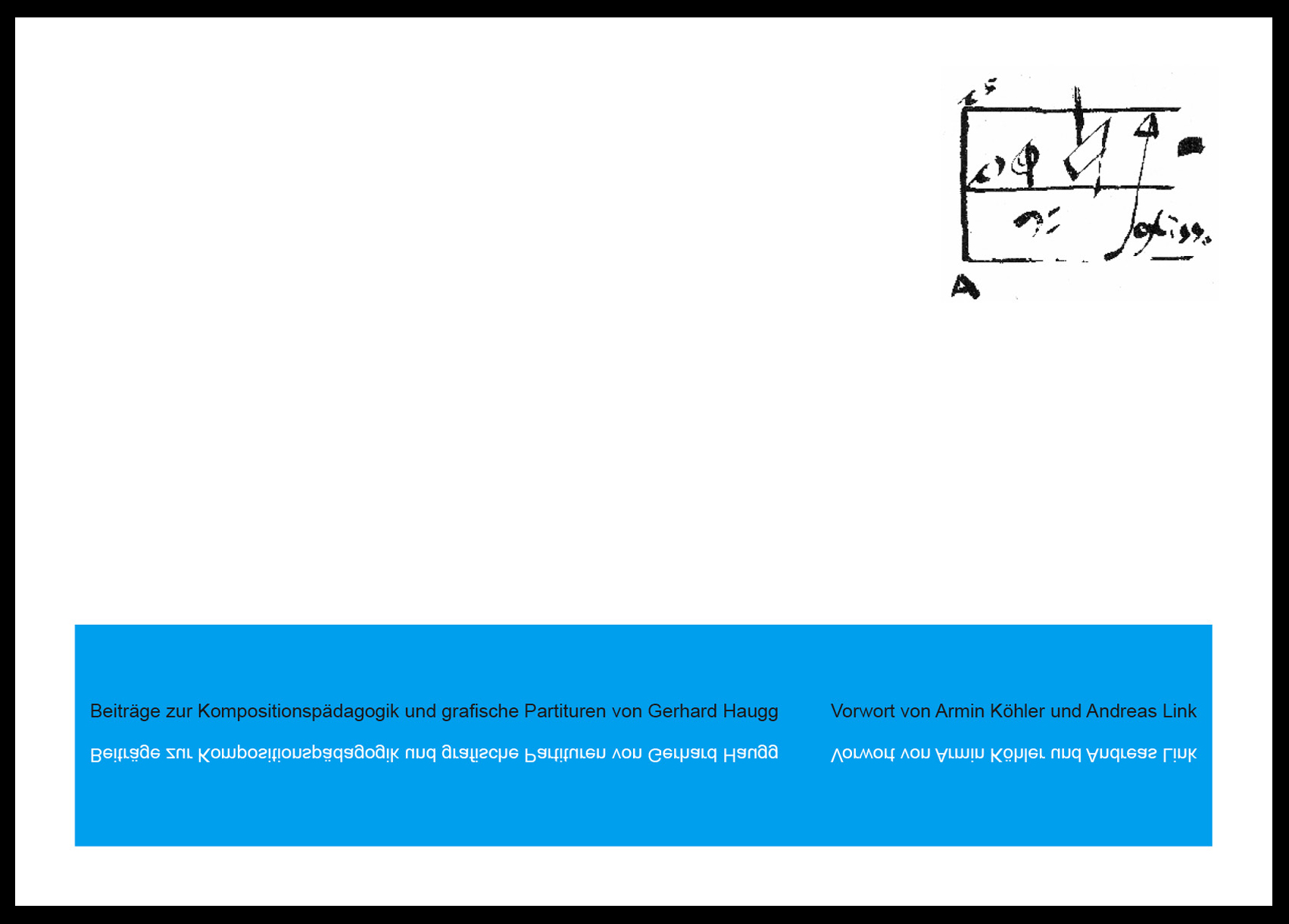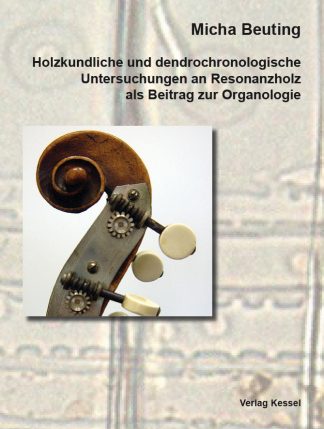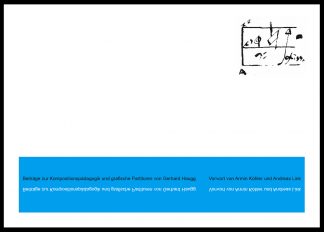Beschreibung
Musik – Grafik – Musikalische Grafik
Aggregatzustände
Musik ist schon ein eigentümliches Phänomen. Wie Wasser besitzt sie mehrere Aggregatzustände. Das war nicht immer so. Als sie noch ausschließlich mündlich weitergegeben wurde, kannte sie nur einen Zustand: den klanglichen. Das heißt, sie war eine flüchtige akustische Erscheinung wie die gasförmige Form von Wasser, um im Bild zu bleiben. Später dann, im frühen Mittelalter, als die Musik immer komplexer wurde, als es galt Klangorganisationen in immer größerem Ausmaß zu bewerkstelligen, kristallisierte sich in unterschiedlichen Varianten ein zweiter Aggregatzustand heraus: der schriftliche. Mit ihm war es möglich, die Flüchtigkeit auszutreiben, klangliche Ideen festzuhalten, also zu speichern. Da aber niemals alle Details einer musikalischen Erfindung notierbar waren, blieb auch bei diesem Zustand immer ein Rest Unverbindlichkeit und Flüchtigkeit, vergleichbar etwa mit dem flüssigen Zustand des Wassers. Mit der Erfindung der Elektrizität im 20. Jahrhundert kam schließlich der dritte Aggregatzustand hinzu, den ich als „gefrorene Zeit“ charakterisieren möchte: die Speicherung auf einem Medium wie Schallplatte, Tonband oder auf einem digitalen Medium. Ein ganz besonders flüchtiges Stadium im Zwischenbereich von Klang und Bild ist die Musikalische Grafik.
Entwicklungsgeschichtlich geht die Entstehung der Notenschrift einher mit dem Bestreben, das Moment des Flüchtigen bannen zu wollen, um seiner habhaft zu werden und es zu jeder Zeit verfügbar zu machen: das Haftende und Zusammenhaltende einer Schrift versetzt Musik in einen lesbaren Aggregatzustand, durch den sie reproduzierbar, aber auch komponierbar wird. Musik steht uns durch ihre Aufzeichnung zur Verfügung. Wir können sie damit analysieren, manipulieren und sie in unseren Entwicklungsprozess mit einbeziehen. Die Notenschrift ist also ein Speichermedium von Klang. Die Notenschrift ist zugleich aber auch mehr und weniger als eine Schrift: sie ist ein Bild, eine Werkzeichnung, eine grafische Darstellung, ihr ist mithin immer auch ein gewisser ästhetischer Wert eigen. Sie kennen sicherlich die wunderschönen Tabulaturen des Mittelalters, die Musikdrucke Josquin Desprez‘ oder die dynamische, die klangliche Linienführung geradezu nachzeichnende Handschrift Johann Sebastian Bachs, die in Drucken mittlerweile so manches Wohnzimmer schmückt. Diese ästhetische Komponente erhielt im 20. Jahrhunderts teilweise einen Eigenwert, in dessen Folge sich eine vollkommen neue musikalische Gattung, die Musikalische Grafik, herauskristallisieren konnte.
Hintergründe eines Wandels
Notation ist kein „Ding an sich“ sondern Resultat vielschichtiger sozialer, ästhetischer und kompositionstechnischer Prozesse und wirkt ihrerseits wiederum intensiv auf diese zurück. Wandlungen der Notenschrift sind daher stets innerhalb dieses komplexen Beziehungsgefüges zu sehen. Analog dem bedeutsamen Wandel um 1600 von der weißen Mensuralnotation zur heute zum überwiegenden Teil noch gültigen Symbolnotenschrift und von der Stimmenordnung zur Partiturordnung kann auch der gegenwärtige Umgestaltungsprozess nicht als autonom notationstechnischer Vorgang gewertet werden. Notationsveränderungen waren damals ebenso Resultat als auch Voraussetzung von Mutationen innerhalb der musikalischen Ästhetik, Aufführungspraxis und Kompositionstechnik, wie sie es heute auch sind. Und so, wie zu jener Zeit damit in unmittelbarem Zusammenhang Veränderungen im sozialen Bereich standen – man denke an die Herausbildung des Komponisten als eigenständiger Beruf und entsprechende Individualisierungserscheinungen oder an den Wandel im musikalischen Kommunikationsprozess von der Umgangs- zur Darbietungsmusik – müsste ähnliches auch heute zu konstatieren sein. Die Umgestaltung der Notenschrift, wie sie für die Mitte des 20. Jahrhunderts charakteristisch ist, ist demnach als Syndrom derartiger Erscheinungen zu erfassen und darzulegen.
Erst durch die Notation kann der Komponist seine Klangvorstellungen fixieren, dadurch dem Interpreten mitteilen, um schließlich eine akustische Realisation zu ermöglichen, durch die ein musikalisches Kunstwerk seine Funktion im Kunstprozess erst zu erfüllen vermag. Eine Ausnahme in diesem Zusammenhang bildet die elektroakustische Musik, bei der der Komponist Schöpfer und gleichzeitig Interpret seines Werkes ist. Eine schriftliche Form ist hier nicht mehr nötig.
Die musikalische Schrift muss also zwei Funktionen erfüllen, die im dialektischen Verhältnis zueinander stehen: Einerseits hat sie kompositorische Intentionen grafisch angemessen zu transkripieren, andererseits sollte sie diese in jederzeit reproduzierbarer Form festhalten. Sie ist sozusagen ein Code, der sowohl den Erfordernissen des Kompostionsprozesses gerecht werden muss als auch den technischen Voraussetzungen der Klangerzeuger und deren spezieller Handhabung durch den Instrumentalisten. Dabei spielt die wechselseitige Beeinflussung von kompositorischer Intention und grafischer Darstellung, also Codierung, eine besondere Rolle. Innerhalb dieses Spannungsfeldes ist auch der notationstechnische Schlüssel zu finden, weshalb veränderte Organisationsformen und neue Bezugssysteme des musikalischen Materials neue Überlegungen zur Beschaffenheit und Funktion der musikalischen Schrift auslösten. Entsprechend der sich allmählich verändernden Vorstellungen vom Gehalt der Musik und ihrer sozialen Funktion galt es Notationen zu finden, die der neuen Form- und Klangwelt möglichst adäquat sind und zugleich dem Musiker weiterhin klare Interpretationsanweisungen vermitteln. Auf Grund solch historisch gewachsener Kommunikationsmechanismen war man, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen in den ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts, bestrebt, die Verbindung zur Vergangenheit nicht abreissen zu lassen, sich also weiterhin ausschließlich der überlieferten Symbolnotenschrift zu bedienen, beziehungsweise diese geringfügig zu erweitern. In der Mitte des 20. Jahrhunderts war jedoch die Divergenz zwischen den Darstellungsmöglichkeiten dieser Schrift und den veränderten ästhetischen sowie kompositionstechnischen Anforderungen so groß geworden, dass eine Beschränkung auf sie allein unmöglich wurde.
Intellekt und Empathie
Seither lassen sich innerhalb der Notationsgeschichte grob schematisiert zwei Tendenzen ausmachen, deren Quellen zwar in verschiedenen Kompositionsverfahren zu suchen sind, die aber letztendlich ein und denselben Ursprung haben: die neuartigen Beziehungen zwischen Klangraum und musikalischer Zeit sowie zwischen Klang und Stille. Diese galt es so eindeutig wie möglich darzustellen, um die sich daraus ergebenden veränderten Klangorganisationen durch Interpreten realisieren zu können. Da wäre auf der einen Seite die Tendenz zum Eindeutigen und Präzisen zu nennen, die im Zusammenhang zu sehen ist mit der Emanzipation des Konstruktiven im kompositorischen Denken und dessen Implikationen mit der musikalischen Schrift. Auf der anderen Seite ist die Neigung zum Mehrdeutigen, Vagen und Unbestimmten zu konstatieren, resultierend aus der Einbeziehung von Zufallsoperationen in die musikalische Kompositions- und Aufführungspraxis. Diese beiden gegensätzlichen Erscheinungen stehen einander gegenüber, ergänzen sich, beeinflussen einander oder grenzen fundamental verschiedene Sphären gegeneinander ab.
Die erste Tendenz ist eng an die sogenannten seriellen Prinzipien gebunden, die zu Beginn der 50er Jahre eine wichtige und einflussreiche Kompositionsrichtung ausprägten und deren strukturelle Organisationsweisen auf zahlenkombinatorischen Verfahren aufbauen. In serieller Musik wurden Kompositionstechniken, die Arnold Schönberg und Anton Webern mit der Dodekaphonie entwickelten, konsequent weitergeführt bis hin zur mathematischen Codierung sowohl jedes einzelnen kompositorischen Parameters wie Tonhöhe, Tondauer, Tonintensität und Tonfarbe als auch des Tonsatzes hinsichtlich Dichte, Menge, Artikulation, Ambitus und Instrumentation. Die darin anvisierte Parität innerhalb und zwischen den einzelnen Parametern führte nicht nur zur Auflösung darin begründeter Zusammenhänge und zur Konstituierung neuer Verhältnisse, sondern veränderte ebenso das Beziehungsgefüge zwischen den Parametern. Die überlieferte Symbolnotenschrift basiert aber bekanntlich auf dem funktional-harmonischen Denken, mit all seinen Implikationen einschließlich einer festgelegten hierarchischen Ordnung der musikalischen Parameter. Ausdruck eines solchen hierarchischen Denkens sind die bekannten Symbole innerhalb des fünflinigen Rasters. Bei diesem Schriftbild wird bestimmten Toneigenschaften, nämlich der Höhe und Dauer, Priorität gegenüber anderen (Intensität, Farbe) zuerkannt. „Die serielle Kompositionstechnik aber räumt den ‚peripheren‘ Parametern das gleiche Recht auf Differenzierung ein, wie den ‚zentralen‘. Sie durchkreuzt die Hierarchie der Toneigenschaften, die der traditionellen Notation zugrunde liegt.“ (Carl Dahlhaus, 1965) Die Symbolnotenschrift ist zudem ausgerichtet auf die Darstellung metrischer, das heißt taktrhythmischer Verhältnisse. Dabei beruht die traditionelle Rhythmusnotation auf zwei Prinzipien: „sie ist einerseits multiplikativ (bzw. divisiv), andererseits binär. Die Zeichen der Achtel-, Viertel-, Halben und Ganzen Noten stellen eine Reihe dar, der die Proportion 1:2:4:8 – und nicht 1:2:3:4 – zugrunde liegt. Und die Proportion 1:2:4:8 entspricht einer Rhythmik, in der zwei Unterteilungswerte eine Zählzeit, zwei Zählzeiten einen Halbtakt, zwei Halbtakte einen Takt und zwei Takte eine Phrase bilden … Eine rhythmische Skala, die der Reihe der ganzen Zahlen entspricht (1:2:3:4…), ist in der multiplikativen Notation nur durch das Anbinden von Noten vollständig darstellbar: durch ein Verfahren, das unverkennbar sekundär ist. Das Bezugssystem, das der multiplikativen Notation zugrunde liegt, ist die Taktrhythmik; der seriellen Rhythmik ist die Notation inadäquat. Eine genaue Darstellung serieller Rhythmik wäre ein Notationssystem, in dem der fünfte Zeitwert der Skala nicht als Viertelnote mit angebundener Sechzehntel, sondern als unzusammengesetzter Zeitwert erscheint.“ (Carl Dahlhaus, 1965)
Sowohl die Loslösung von der Taktrhythmik, als auch die stärkere Differenzierung klanglicher und metrische rhythmischer Einheiten sowie das Bestreben, diese mittels der traditionellen Schrift möglichst präzis darzustellen, verursachte schließlich ein über Gebühr kompliziertes Notenbild, das in seiner Überbestimmtheit letztendlich kaum noch adäquat realisierbar ist. Die mögliche Genauigkeit von Notation auf dem Papier hat den Höhepunkt tatsächlicher Kontrollierbarkeit der Ausführung überschritten und geriet in den Bereich menschlicher Verantwortung, wo sie abermals nur zur approximativen Andeutung und Suggestion von Handlungen wurde.“ (Carl Dahlhaus, 1965)
Zeichen und Zeichnung
In diesem Zusammenhang ist auch die nahezu unüberschaubare Zeichenakkumulation zu sehen. Sie ist Ausdruck dafür, dass die überlieferte Schrift im Hinblick auf das neue Klangdenken ihre Grenzen erreicht hat. Klang hat sich von nun an zum gleichrangigen kompositorischen Parameter emanzipiert, bestimmt nicht nur die Gestalt eines Werkes mit und erhält dadurch sozusagen thematische Bedeutung, sondern prägt darüber hinaus in besonderem Maße den Grad an Subtilität und Nuanciertheit von Musik. Vollkommen neue Klangerzeuger werden ebenso verwendet wie neue Musizierformen entwickelt. Das meint nicht nur die Erfindungen im elektroakustischen Bereich, sondern generell die Erweiterung der Klangpalette durch alle nur möglichen Geräusche. Hierzu zählt zum einen der größere Anteil des Geräusches am Ton, erzielt durch entsprechende Artikulationsweisen auf traditionellen Instrumenten wie Überblaseffekte bei den Blasinstrumenten, Präparationen der Saiten eines Flügels oder Spiel auf dem Korpus bei den Streichinstrumenten, um nur einige wenige Beispiele aus dem großen Arsenal zu nennen. Zum anderen finden an sich kunstfremde Materialien und Klangerzeuger Verwendung.
Die hier angedeuteten primär strukturellen Komplikationen der schriftlichen und akustischen Umsetzung gelten jedoch längst nicht als Hauptgrund für die Herausbildung neuer musikalischer Codierungsformen. Wesentlicher noch war die als zweite Tendenz gekennzeichnete Einbeziehung des Zufalls in den Kompositions- und Aufführungsprozess seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Damit änderten sich die musikalischen Organisationsprinzipien grundsätzlich, was schließlich zur Auflösung der um 1600 etablierten Werkform führte.
Die Form einer Komposition blieb variabel, da sie nunmehr durch den Interpreten von Aufführung zu Aufführung nach intuitiven Entscheidungen immer wieder neu zusammengestellt werden konnte. Und es zeigte sich, dass derartige Vorstellungen mittels einer interlinearen Entwurfsschrift, die von genauen Festlegungen hin zu einer mehr bildhaft-assoziativen Informationsvermittlung tendiert, angemessener zu fixieren sind als mit der herkömmlichen Symbolnotenschrift. Diese sogenannte „Aktionsschrift“ vermittelt nicht mehr in erster Linie und exakt das, was erklingen soll, sondern gibt durch verbale Anweisungen unterschiedliche Lineaturen, Punkte, Flächen, Notenschriftfragmente u.ä. vor, wie der betreffende Klang zu erzeugen ist. Damit wird der Interpret unmittelbar zum kreativen Mitgestalter der Komposition, er erhält die Möglichkeit, spontan zu reagieren und eigene musikalische Vorstellungen einzubringen. Gleichzeitig veränderte dies grundsätzlich den Status des Komponisten. Kulminationspunkte dieser Entwicklung sind die Musikalische Grafik und die Verbalpartitur.
Erwähnt sei noch, dass notationstechnische Veränderungen über die Erweiterung der klanglischen und rhythmischen hinaus auch aus der Einbeziehung theatralischer Aktionen, ja, aller zur Verfügung stehenden Künste wie Film, Tanz, Pantomime, Malerei, Grafik usw. resultieren. Sie entstammen also jenem ästhetischen Bereich zwischen „Theatralischer Musik“ und „Instrumentalem Theater“, durch den nicht zuletzt auch konventionelle Aufführungspraktiken im Konzertsaal aufgehoben werden. Auch wenn der soziale Bereich hier nur oberflächlich erwähnt werden kann, so ist doch auch wieder in unserem Jahrhundert zu beobachten, dass die Auflösung tradierter Kommunikationsformen, beispielsweise des Darbietungsmodells europäischer Konzertmusik, für die Mutation der musikalischen Schrift von entscheidender Bedeutung war und ist.
Freie Formen
Während sich in den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Großteil vor allem westeuropäischer Kompositionen immer mehr in Richtung des Kontrollierten, Systematischen, Logischen, bis ins Detail Organisierten entwickelte, gewann zur selben Zeit in den USA eine Musik an Bedeutung, die musikalische Prozesse immer weniger rationalisierte und schließlich Elemente des Zufalls in den Rang einer eigenständigen kompositorischen Kategorie erhob. Bereits seit 1949/50 ließen Komponisten wie John Cage, Morton Feldman, Earle Brown und Christian Wolff, jeder auf seine Weise, Zufallsmanipulationen in den Kornpositions- beziehungsweise Aufführungsprozess einfließen. Resultat waren Kompositionen von größerer Flexibilität, Offenheit und Mehrdeutigkeit, waren künstlerische Entwürfe, deren formaler Verlauf von variablen Elementen und entsprechenden Interpretationsfreiheiten mitbestimmt wird. Musikalische Kausalität im europäischen Sinne konnte dadurch graduell und in bestimmten Kompositionen generell außer Kraft gesetzt werden, wodurch zentrale europäische Kategorien wie die der „Komposition“ und die vom „Werk“ als ein in sich geschlossenes ästhetisches Gebilde damit letztendlich aufgehoben wurden.
Der Einfluss dieser nordamerikanischen Ideen sowie die am Ende der 50er Jahre zunehmende Kritik an der streng determinierten Ordnung der seriellen Verfahren bewirkten, dass zu Beginn der 60er Jahre Zufallsprinzipien auch in Europas musikalischer Praxis weitreichende Verbreitung erfuhren. Wenn gegenwärtig derartige Verfahren durch eine Vielzahl von Termini, wie „Offene Form“, „Mobile Form“, „vieldeutige Form“, „Aleatorik“, „gelenkter Zufall“ oder „Zufallskomposition“ bezeichnet werden, so resultiert das nicht nur aus dem Versuch, unterschiedliche Formdispositionen innerhalb ein und desselben Prinzips, das heißt unterschiedliche Grade von Unbestimmtheit und Zufallseinbindung, zu kategorisieren, sondern es ist zugleich ein Hinweis darauf, dass sich derartige Phänomene einer definitiven Festlegung entziehen, da eine klare Abgrenzung zwischen ihnen kaum möglich ist. Vielmehr sollte man ganz allgemein von Indetermination der musikalischen Form sprechen, und darin alle entsprechenden Formen einbeziehen, sowohl freie Anordnungen musikalischer Strukturen als auch solche, die grundsätzlich dem Zufall überlassen bleiben, die frei von vorgefassten Ideen sind und deren konkrete Gestalt in keiner Weise vorauszusehen ist.
Unschärferelationen
Gegenwärtig lassen sich drei Grundprinzipien unterscheiden, die in der Praxis allerdings kaum in reiner Form auftreten, sondern gleichwohl vermischt und übereinanderprojiziert erscheinen. Da sind zunächst einmal zwei Verfahren zu nennen, die gegenwärtig pauschal unter dem Oberbegriff „Aleatorik“ zusammengefaßt. werden. Beim ersten gibt der Komponist den Verlauf des Stückes, also seine Form und Dauer, verbindlich vor und überlässt die Gestaltung der Details in dessen Inneren dem Interpreten, Das trifft zum Beispiel auf Witold Lutoslawskis Venezianische Spiele (1961), auf Krzystof Pendereckis Threnos (1961) oder Werke anderer, vorwiegend polnischer Autoren zu. Beim zweiten Verfahren werden die Einzelheiten genau fixiert, hingegen legt der Interpret die Anordnung der Formteile fest. Hierzu zählen die 3. Klaviersonate von Pierre Boulez (1955), das Klavierstück IX (1954/55) und Zyklus für einen Schlagzeuger (1959) von Karlheinz Stockhausen oder Mobile (1956) für zwei Klaviere von Henri Pousseur.
Das dritte Verfahren schließlich ist in seiner konsequentesten Ausrichtung nahezu nur an einen Komponisten gebunden, der damit zweifellos eine Sonderstellung einnimmt: an den Amerikaner John Cage. Während die oben genannten Verfahren in gewissem Maße immer noch der herkömmlichen Vorstellung von „Komposition“ genügen, im Sinne der Arbeit mit instrumental, vokal oder elektroakustisch erzeugten mehr oder weniger kausalen Tonverbindungen, versteht Cage alle verfügbaren Klänge als Musik. Seines Erachtens „konnte jeder Klang durch die einfache Tatsache musikalisch werden, dass er in ein musikalisches Stück aufgenommen werden kann.“ Damit stellt er nicht nur den abendländischen Werkbegriff auf den Kopf, sondern grundsätzlich das Verständnis dessen, was bislang unter „Komposition“ verstanden wurde. Wenn Pierre Boulez formuliert „Wir haben das ‚Zu-Ende‘ eines abendländischen ‚Werkes‘, seinen geschlossenen Kreis, respektiert und doch die ‚Chance‘ des orientalischen Werkes, seinen geöffneten Verlauf, eingeführt“ , so ist das charakteristisch für das Verständnis erstgenannter indeterminierter Formmodelle, die trotz freier Anordnung in den Grenzen mehr oder weniger vorgeschriebener Wahrscheinlichkeit bleiben. Cages Unbestimmtheits-Konzept ist umfassender. Er besteht auf der konsequenten Anerkennung von Zufallsoperationen, so dass, je nach Grad der Unbestimmtheit, prinzipiell alle musikalischen Parameter und Aufführungsmodalitäten unbestimmt bleiben können.
Ausgangspunkt seines Konzeptes ist die Neudefinition des Wesens der Stille, vornehmlich deren paritätische Gleichsetzung mit dem Klang. „Ich beabsichtige“ so schreibt Cage, „wie Satie oder Webern vorzugehen: Struktur entweder mit Klängen oder mit Stillen zu verdeutlichen.“ Dabei gibt es für ihn eine absolute Stille nicht. Er ist vielmehr der Ansicht, dass uns stets Klänge umgeben, auch in einem schalltoten Raum, in dem der eigene Körper zum „Objekt“ des Hörens wird. Das heißt, Stille ist „schon Klang und sie ist immer wieder Klang oder Geräusch“, sie ist „die Gesamtheit unbeaufsichtigter Klänge.“ Jedoch „Klang und Stille auszutauschen bedeutet vom Zufall abzuhängen.“ Stille meint also „die ganze Klangweit, das Leben selbst; und ihr Erscheinen in der Musikwelt bedeutet das Ende dieser exklusiven Tätigkeit, Kunst genannt, durch die der Komponist eine isolierte Handlung ausführte, dazu bestimmt, die ‚Dunkelheit‘ zu erleuchten, nämlich die des chaotischen Alltagslebens.”
Klangstille
Paradigmatisch für dieses Denken ist seine Komposition 4’33“; Tacet für beliebiges Instrument oder beliebige Kombination von Instrumenten aus dem Jahre 1952. Innerhalb von vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden erklingt kein Ton im traditionellen Sinne, verharrt der Interpret in Spielhaltung, ohne einen Klang oder auch nur ein Geräusch zu erzeugen: es herrscht Stille. Keine absolute Stille, denn alle Klänge, auch jene aus der Umgebung, die während dieser 4 Minuten und 33 Sekunden zufällig auftreten, können als Musik angesehen werden. Noch konsequenter verfährt Cage zehn Jahre später in einer Variante dieses Stückes, wie schon dessen Titel erkennen läßt 4’33“ (No. 2) (0’00‘, Solo, auf beliebige Weise von jedermann aufzuführen).
Zunächst arbeitete Cage nur bei der Ausarbeitung seiner Kompositionen mit Zufallsoperationen, wobei er nach dem I Ging, einem alten chinesischen Orakelbuch verfuhr und die Klänge und ihre Abfolge durch das Werfen von Münzen festlegte, so dass das subjektive Moment – der individuelle Geschmack und das Gedächtnis – aus dem Kompositionsprozess ausgeschaltet wurde. Möglichkeiten eines schöpferischen Mitgestaltens des Interpreten sah er bis 1955 nicht vor. Erst danach weitete er das Zufallsprinzip auch auf den Interpretationsprozess aus, wodurch die Kreativität des einzelnen Musikers herausgefordert wird, er zu einer neuen Freiheit des Musizierens finden soll. Beispiel hierfür ist das Concert for piano and orchestra (1957/58), in welchem die Musiker frei nebeneinanderher musizieren, und der Dirigent nur die Funktion eines Zeitgebers besitzt: Weder er noch der Komponist üben damit ‚diktatorische‘ Macht über den Interpreten aus, der sich vielmehr frei entfalten kann. Überhaupt gründet dieses Verfahren auf einem sehr demokratischen Musikverständnis. Denn jeder Kommunikationspartner, vom Komponisten über den Interpreten bis hin zum Rezipienten, erhält die Möglichkeit, sich schöpferisch einzuschalten oder zumindest die Art seines Verhaltens zu erklingenden Musik selbst zu bestimmen und dementsprechend auch die emotionale Auseinandersetzung mit ihr.
Opera Aperta
All diese Prozesse leiteten Wandlungen des europäischen musikalischen Kommunikationsprozesses ein. Vornehmlich wurde der Darbietungsmechanismus der bürgerlichen Konzertform in Frage gestellt. Damit waren letztendlich auch Zweifel an der Endgültigkeit des autonomen Kunstwerks verbunden. Man begann Formen des umgangsmäßigen Gebrauchs von Musik wiederzuentdecken, Formen des aktiven Mitvollzugs des hörenden und sehenden Besuchers. Mitvollziehen meint dabei nicht nur Eingreifen in die Musik durch aktive Klangerzeugung, sondern ebenso eine neue Qualität innerer Aktivität beim Hören, meint eine veränderte Form des Sich-in-Beziehung-Setzens zum akustischen Resultat durch den Hörer. Denn eine solche Musik will ihm kein bestimmtes Verhalten, kein emotionales Empfinden aufzwingen, da hier weder Gedächtnis noch Vorwegnahme, die psychologischen Maximen der traditionellen Musik, eine Rolle für die Qualität musikalischer Wahrnehmung spielen. Sie stellt den Hörer nicht unter intellektuellen Leistungszwang, vielmehr soll er nach eigenem Belieben seine Erfahrungen mit der Musik machen.
Alle Quellen anzuführen, die zur Einbindung des Zufalls in die musikalische Gestaltung führten, ist nicht möglich. Das würde den Rahmen dieses Programmheftes bei weitem sprengen. Verwiesen sei lediglich noch darauf, dass allen angedeuteten Prinzipien die Beschäftigung mit fernöstlicher Philosophie gemeinsam ist, etwa mit dem Zen-Buddhismus und entsprechenden musikalischen Strukturprinzipien wie beispielsweise den Tâla- und Râga-Systemen der Inder. John Cage wurde zudem inspiriert von den philosophischen und politischen Ideen desTranszendentalisten und Predigers Henry David Thoreau, des Architekturphilosophen Buckminster Fuller und des Medienforschers Marshall McLuhan.
Ausschlaggebend für die Herausbildung freier Formen in Europa waren darüber hinaus der Einfluss der Literatur, etwa die Arbeiten von Stephane Mallarmé oder James Joyce, und schließlich die inneren Widersprüche der seriellen Musik selbst. Denn „das serielle Verfahren war in ein Dilemma, in eine Unstimmigkeit zwischen Teil und Ganzem, geraten. Wurden die Einzelheiten eines musikalischen Textes in sämtlichen Toneigenschaften, in der Tonhöhe, Dauer, Lautstärke und Klangfarbe, durch Reihen bestimmt, so war, wenn man nach der Setzung der Regeln und Anfangsbedingungen die serielle Mechanik sich selbst überließ, die Gesamtform zufällig. Und umgekehrt: werden die Merkmale der Gesamtform, die Dauer der Teile, die Ordnung der Zeitmaße, durch eine Reihendisposition festgesetzt, so war es unmöglich, die Details konsequent seriell auszuarbeiten. Die Idee einer Musik, die restlos aus einem einzigen Prinzip erwächst, in der also sowohl das Ganze als auch die Einzelheiten seriell determiniert sind, erwies sich als utopisch: entweder entzog sich die Gesamtform oder aber das Detail dem Reihenprinzip und blieb, nach seriellen Kriterien, dem Zufall überlassen.“ (Carl Dahlhaus, 1972)
Farbakkorde
Als weitere Quelle muss auf Anregungen aus der bildenden Kunst hingewiesen werden, so auf Arbeiten Marcel Duchamps wie dessen Erratum musical (1913) oder Die Ehefrau, von ihren Junggesellen entblößt, selbst (1913), denen er ein Zufallsarrangement zugrunde legte, oder auf die weißen Gemälde von Robert Rauschenberg, die John Cage inspirierten. Ebenso müssen die mobilen Konstruktionen von Alexander Calder erwähnt werden, die „action-painting-Technik“ Jackson Pollocks, eine Methode des gleichzeitigen Komponierens und Agierens, und das Buch Beyond painting von Max Ernst, die Morton Feldman und Earle Brown anregten, spontane Entscheidungen, insbesondere bei der Aufführung ihrer Kompositionen, einzubeziehen. Brown führte dazu aus: „Es ist bekannt, dass die Notation stets eine Quelle von Schwierigkeiten und Versagungen für den Komponisten war, da sie eine relativ unvollkommene und unvollständige Transkription dessen darstellt, was ein Komponist traditionellerweise ‚hört‘, und es sollte keineswegs überraschen, dass ihre Entwicklung andauert. Sie dient als Vokabular und Interpunktion einer abstrakten Sprache, deren Syntax potentiell unendlich ist. Die Schwierigkeiten, alle artikulierten und unartikulierten Wendungen beim ‚Sprechen‘ dieser Sprache zu bezeichnen, sind immens. Früher war ich sehr neidisch auf die Maler, die unmittelbar mit der Realität ihres Werkes umgehen können, ohne des indirekten und ungenauen Studiums der ‚Übersetzung‘ zu bedürfen. Ich pflegte sie im Gespräch zu fragen, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie sich hinsetzen und eine Reihe von Anweisungen schreiben müßten, nach denen ein anderer exakt zu malen vermochte, was sie selber bis in alle Einzelheiten malen. Ich habe viel über dieses Problem des unmittelbaren Kontakts zwischen dem Komponisten und den Klängen nachgedacht, und dies hatte seine Auswirkungen auf meine Beschäftigung mit Notation und Ausführung – am offensichtlichsten in Folio und auf entfalteter Stufe in Available Forms, wo der Dirigent in der Tat mit einer Pallette komponierter Klangereignisse ‚malt‘ (‚formt‘).“ (Earle Brown, 1952)
Es war also auch die musikalische Schrift selbst, die Methode des Fixierens von Musik, die letztendlich ein Umdenken und damit ihre eigenen Strukturveränderungen mit beförderte. „Die Geschichte der abendländischen Musik untersteht der Dialektik von musikalischer Aktion und Notation. Die Notation, die der Aktion, zunächst als Gedächtnisstütze, folgte, hatte eine Eigengesetzlichkeit entwickelt, die sie bald der Aktion vorgeordnet hat: die Orthographie nahm Einfluss auf die Grammatik. Die Reihenfolge Aktion – Notation, meint Improvisation – Tradition, ist die Reihenfolge Aktion – Notation, meint Komposition – Interpretation, umgeschlagen.“ (Ulrich Siegele, 1972) Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte und in dessen Verlauf immer weitere Merkmale der Musik – zunächst die Tonhöhe und die Tondauer, später das Tempo, die Dynamik und die Klangfarbe – in die Schrift übergingen, also aus einer Sache der Interpretation zu einem Teilmoment der Komposition wurden.
Mit der Einbeziehung von Zufallsoperationen wurde dieser Prozess nunmehr gestoppt und letztendlich in sein Gegenteil verkehrt. Der Spielraum zwischen Aufzeichnung und Ausführung erweiterte sich wieder bei solchen Kompositionen, die längst nicht mehr alle musikalischen Parameter schriftlich festlegen konnten. Die Schrift passte sich vielmehr der Flexibilität der neuen Formdispositionen an, dient damit nicht mehr ausschließlich der genauen Kontrolle, sondern fördert spontane Entscheidungen. Vom genauen Plan zur Erzeugung von Klängen wandelte sie sich wieder zu einer mehr oder weniger präzisen Umschreibung von Tätigkeiten zu ihrer Hervorbringung. Mehr noch: durch mobile Formen, die in den frühen 50er Jahren vornehmlich von Morton Feldman und John Cage enwickelt wurden, erlangte Notation durch bildhafte Eigenständigkeit erstmals in ihrer Geschichte Autonomie gegenüber dem klingenden Ereignis. Damit veränderte sie mehr oder weniger auch die Funktion von Musik beziehungsweise stimulierte die Ausprägung neuer Gattungen, wie die der Musikalischen Grafik. Kompositionen, die derartig offen und mehrdeutig notiert sind, haben, mit Ausnahme der „Musikalischen Grafik“, ihre reale Form letztendlich weniger im festgeschriebenen Notentext als vielmehr in der Aufführung. So hat dann auch John Cage das Concert for piano and orchestra nicht mehr in Partiturform, sondern in einzelnen Stimmen fixiert oder die Partitur der Variations V (1965) a posteriori nach der Aufführung niedergeschrieben. „Das änderte unsere Vorstellung davon, was eine Partitur ist. Bis jetzt war sie für uns immer ein Apriori und die Aufführung war die Aufführung einer Partitur. Ich habe das vollständig auf den Kopf gestellt, sodass die Partitur jetzt ein Bericht der Aufführung ist:‘ Dies hat jedoch nicht nur Folgen für die Funktion einer Partitur, sondern umfasst auch grundlegend die Mutation der sozialen Stellung des Komponisten, der in diesem Falle eher als Chronist denn als Komponist zu begreifen ist.
Musikalische Grafik
Schlagwortartige Termini besitzen stets eine besondere Eigenart. Blitzartig erhellen sie nur bestimmte Aspekte des Gemeinten, während sie andere im Dunklen lassen. Nicht anders verhält es sich mit diesem von Roman Haubenstock-Ramati geprägten Begriff. Eindeutig verweist er nur auf ein Konzept im ästhetischen Spannungsfeld von Musik und bildender Kunst, das sich bestenfalls auf Musik und Grafik reduzieren läßt. Doch auch deren Beziehungen und Korrelationen sind so vielschichtig und vielgestaltig, dass im Hinblick auf eine Beschreibung des ästhetischen Bereichs, auf den er ursächlich zielt, weiter eingegrenzt werden muss. So können wir davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um bildnerisch-musikalische Kunstwerke handelt, die von bereits bestehenden Kompositionen ausgehen und deren musikalische Struktur sozusagen visualisieren wie die streng geometrischen Gebilde von Jakob Weder, Heinrich Neugeboren oder Ellen Banks. Ebensowenig bezeichnet Musikalische Grafik die collageartige Aufbereitung handschriftlicher Partituren von Bach bis Strawinsky, beispielsweise durch Jiri Kolar und Lazlö Lakner, oder solche intermediären Werke wie die des synchronistischen Maler-Komponisten Morgan Russel, der Kompositionen zu seinen Bildern nach deren Ausführung entwarf.
Gemeint ist vielmehr ein musikalisches Phänomen innerhalb der bildenden Kunst, das eine Doppelfunktion als musikalisches Zeichensystem und autonome Zeichnung zu erfüllen hat. Dieser Doppelcharakter ist entscheidend bei der begrifflichen Bestimmung und Wertung derartiger künstlerischer Entwürfe. Ein Definitionsversuch, der die Musikalische Grafik als eine in bildästhetischen Qualitäten sublimierte musikalische Schrift festlegt, die sowohl als Anweisung zum Produzieren von Tönen gedacht ist als auch als autonomes Bild, das man sich sozusagen an die Wand hängen kann, scheint daher auf den ersten Blick gerechtfertigt, ist aber nicht vorbehaltlos zu akzeptieren. So lässt er solche Arbeiten außer Betracht, die ausdrücklich nicht Vorlage einer musikalischen Interpretation sein wollen, wohl aber als musikalische Erfindung zu verstehen sind. Hierzu zählen eine ganze Reihe durch die „Concept Art“ inspirierte Blätter von Haubenstock-Ramati. Ein ästhetischer wie kompositionstechnischer Zugang zur Musikalischen Grafik einzig und allein über die musikalische Schrift, wie er ursprünglich von Haubenstock-Ramati selbst durch seine Definition als „mehrdeutige Notation“ vorgenommen wurde, ist dem Gegenstand also nicht vollends angemessen, da er sich wesentlichen Kriterien der bildnerischen Notation verschließt und damit dem semantischen Aspekt Priorität gegenüber dem visuell-ästhetischen einräumt. Eine Definition müßte paritätisch beide Seiten einbeziehen, was sich in der Praxis allerdings als problematisch darstellt.
Denn der Sachverhalt entzieht sich bei einem genaueren Bestimmungsversuch der exakten Definition, da die Grenze zwischen Zeichen und Zeichnung, zwischen musikalischer Schrift und autonomer Grafik, fließend ist, zumal auch autonom gedachte grafische Elemente Zeichenfunktion erfüllen können. Beispielsweise eignet sich die grautönige Schattierung des Untergrunds eines Blattes, also ein an sich rein bildästhetisches Detail, ausgezeichnet zur Darstellung von Intensitäten jeglicher Art, worunter sowohl Lautstärkegrade als auch ganz allgemein Intensität der musikalischen Aktionen verstanden werden können.
Vom Ornament zur Autonomie
Obwohl Vorformen in den reich verzierten Tabulaturen des späten Mittelalters ebenso nachweisbar sind wie in den grafisch vielgestaltigen Madrigalkompositionen der Renaissance, die unter anderem kreisförmig notiert wurden, können derartige künstlerische Gebilde erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als eigenständiger ästhetischer Bereich betrachtet werden. Direkte philosophische, ästhetische und kompositionstechnische Quellen Musikalischer Grafik sind denn auch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachweisbar. Den Grundstock bilden zwei grundlegende Gemeinsamkeiten verschiedenster künstlerisch-avantgardistischer Bestrebungen dieser Zeit. Da wären auf der einen Seite Tendenzen zur Fusionierung der einzelnen Kunstgattungen zu nennen. Hierzu zählen die kalligrafischen Gedichte Guillaume Apollinaires, die typografischen Versuche EI Lissitzkys und solche Simultankunstwerke wie Sport et divertissement (1914) von Erik Satie. Er und sein Freund Marcel Duchamp haben im Grunde auch die geistige Haltung zum Ordnungsmechanismus der Musikalischen Grafik mitgeprägt. Denken wir nur an die veränderte Funktion der Musik in Saties Musique d’ameublement (1920) oder an Duchamps spezifische Gestaltung seines Erratum musicale, der zudem bereits ein Zufallsprinzip zugrunde liegt.
Hinzuweisen ist auch auf die Bestrebungen zwischen 1905 und 1915, die einer abstrakten Bildsprache in der bildenden Kunst die Musik als Leitbild zugrunde legten. Vornehmlich deren Immaterialität und ihr Raum-Zeit-Kontinuum empfanden die bildenden Künstler jener Zeit als mögliche produktive Erweiterungen ihres Mediums, die sie zu übertragen suchten. Das äußerte sich letztendlich im Aufbrechen des einheitlichen Bildraums, in der Freisetzung von Motivteilen, vor allen Dingen aber in der Verselbständigung von Strukturen und Farben sowie in einer zunehmenden Dynamisierung der Bildsprache. „Die Frage der Zeit in der Malerei steht für sich und ist sehr kompliziert. Vor einigen Jahren begann man auch hier eine Mauer niederzuschlagen. Diese Mauer teilte bisher zwei Kunstgebiete voneinander – das der Malerei und das der Musik“ , schrieb Wassily Kandinsky noch 1926 in seinem Traktat Punkt und Linie zu Fläche, in welchem er neben anderen Aspekten, die theoretischen Grundlagen zu Zeitphänomenen in der Malerei legte. Den Punkt definiert er als „zeitlich knappste Form“, wohingegen bei der Linie „der Sprung aus dem Statischen in das Dynamische“ vollzogen wird. „Während der Punkt nur eine Spannung in sich trägt und keine Richtung besitzt, hat die Linie hingegen sowohl Spannung als auch Richtung. Das heißt, der Linie ist das Element der Zeit immanent – die Länge ist ein Zeitbegriff“. Dabei ist das Nachgehen einer Geraden vom Nachgehen einer Gebogenen zeitlich verschieden, „wenn die Längen auch dieselben sind, und je bewegter die Gebogene, desto mehr dehnt sie sich zeitlich aus. In der Linie sind also die Möglichkeiten der Zeitverwendung sehr mannigfaltig. Die Verwendung der Zeit in der Horizontalen und in der Vertikalen ist auch bei gleichen Längen unterschiedlich gefärbt.“
Die Einflüsse Kandinskys auf die Pioniere der europäischen Musikalischen Grafik der 50er Jahre werden offenkundig, wenn Haubenstock-Ramati, „die horizontale Achse eines Blattes als die der Zeit (Zeit = Raum) und die vertikale als die der Tonhöhe (unten = tief, oben = hoch)“ definiert und „Punkt, Linie und Fläche – die Grundelemente der abstrakten Malerei und Grafik – zu den Grundelemente der Aufzeichnung von Musik“ macht. „Entscheidend ist dabei die Tatsache, dass nun die abstrakte Form eines Bildes durch das zeitgebundene musikalische Denken entstanden ist.“ Natürlich war Haubenstock-Ramati bekannt, dass Punkt, Linie und Fläche nicht die einzigen Grundelemente der sogenannten gegenstandslosen Malerei sind. Sie wurden für ihn als Musiker aber vorrangig interessant, weil sie im Schwarz-Weiß-Bereich der bildnerischen Notation, einem Bereich, der der musikalischen Notation im Grunde genügt, von besonderer Bedeutung sind.
Auch in Anestis Logothetis‘ Arbeiten mit ihrer relativ streng determinierten Zeichengebung sind direkte Einflüsse Kandinskys nachweisbar. Logothetis funktioniert unterschiedliche äußere Formen des Punktes in suggestive Notengestalten von komplexer Funktion um und macht sich damit Kandinskys Vorstellungen zur Variabilität und relativen inneren Färbung des Grundklanges eines Punktes zu eigen. Darüber hinaus entwickelt er auf der Raum-Zeit-Basis assoziative „Aktionssignale“. Damit wird die abstrakte autonome Bildsprache der bildenden Künstler wieder ihrem Ursprung, der Musik, zugeführt. Dieser Prozess ging einher mit der Emanzipation der musikalischen Schrift, die nun nicht mehr ausschließlich die Funktion von Reproduzierbarkeit musikalischer Gedanken auszuüben hatte, sondern durch Arbeiten von Morton Feldman (Projections, lntersections) und John Cage zu bildhafter Eigenständigkeit gelangte, das heisst autonomen Charakter erhielt und damit ihrerseits grundlegend auf die Funktion von Musik einwirken konnte. John Cage war es auch, der die philosophischen Grundlagen lieferte und sich mit seinen außermusikalischen Plexigrammen (1969) am weitesten auf das Gebiet der bildenden Kunst begab. So, wie seitens der bildenden Kunst Kandinsky in Europa die musikalischen Grafiker inspirierte, waren es in den USA Jackson Pollock mit seinem spontanen Gestalten und Alexander Calder mit seinen mobilen Konstruktionen. Earle Brown, der erstmals 1952/53 in seinen Folio-Stücken diese Einflüsse in eine wechselseitige Beziehung zueinander setzte und mit dem Blatt december 1952 eine von Anweisungen erstmals völlig freie Bild-Partitur, die erste Musikalische Grafik, vorlegte, schreibt dazu: „Für mich musste die Beweglichkeit (oder Veränderlichkeit) eines Werkes während der Aufführung aktiviert werden (eben wie in einem Mobile von Calder) sie musste spontan und intensiv durch den Ausführenden ausgedrückt werden, ganz wie in der Unmittelbarkeit des Kontakts zwischen Pollock und seinen Leinwänden und Materialien. Diese beiden Elemente: Beweglichkeit der Klangbestandteile innerhalb des Werkes und grafische Provokation einer intensiven Mitarbeit des Ausführenden waren für mich die faszinierenden neuen Möglichkeiten für ‚Klangobjekte‘ analog der Skulptur und Malerei.‘
Action Painting und Klangflächen
So verwundert denn auch nicht, dass die amerikanischen Musik-Grafiker die Musikalische Grafik nicht mehr allein nach Sichtbarmachung von Strukturen und Funktionen begriffen, sondern als ein „lebendiges Wesen“, als eine unmittelbare, ja ungestüme Aktion.
Nun handelt es sich aber längst nicht bei allen ausgeprägt grafisch fixierten Arbeiten automatisch um Musikalische Grafik. Vielmehr resultiert die überwiegende Mehrzahl neuer Darstellungsformen aus dem einfachen wie praktischen Grund, die traditionelle Notenschrift zu erweitern, um sie den gegebenen musikalischen Bedingungen anzupassen. Sie bleiben im Bereich der musikalischen Schrift, ohne ins autonom Bildhafte überführt zu werden, wie im Orgelstück Volumina (1962/66) von Györgi Ligeti in den Multiple-Stücken (1970) von Haubenstock-Ramati oder in Cages Aria (1958). Erst wenn der größte Teil der gewählten Zeichen nicht präzis definiert ist, wenn die Elemente eine beabsichtigte grafische Eigenständigkeit besitzen, das heißt bildästhethische Qualitäten dominieren, kann von Musikalischer Grafik gesprochen werden.
Beim überwiegenden Teil dieser Arbeiten wird Zeit gleich Raum gesetzt. Die Vorlage ist nur in Ausnahmefällen in traditioneller Leserichtung von links nach rechts zu lesen. Ansonsten kann das Auge das Blatt spiralförmig, von links nach rechts und umgekehrt, von oben nach unten und umgekehrt „abtasten“, kontinuierlich oder in Sprüngen, einige Elemente auslassend, andere dagegen mehrfach wiederholend. Häufig muss der Interpret selbst entscheiden, ob die Einzelheiten der Grafik relativ exakt akustisch umzusetzen sind, oder ob der gesamte Eindruck des Blattes zur Realisation anregen soll. Im zweiten Fall sind Proportionen ohne Belang. Wird dagegen eine möglichst exakte Realisation der Einzelzeichen angestrebt, sollten diese zunächst in ein bestimmtes Verhältnis sowohl zur Grundfläche des Blattes als auch zueinander gesetzt werden. Erst dann erfolgt deren klangliche Deutung entsprechend ihres individuellen grafischen Charakters. Dabei sind die einzelnen Elemente keineswegs unbegrenzt interpretierbar. Die Stärke einer Lineatur zum Beispiel kann sich auf die Klangstärke, die Klangdichte, die Klangdauer oder den Klangumfang oder auch auf alle vier Parameter zugleich beziehen. Die Entscheidung liegt einzig und allein beim Interpreten. In jedem Falle weist aber die Linie auf die Kontinuität eines Ereignisses hin. Durch Flächen hingegen sollen Klangfelder assoziiert werden, in denen ein bestimmter Duktus vorherrscht. Dabei gibt die grafische Strukturierung der Fläche Hinweise auf die musikalische Struktur. Die so fixierten Klangfelder können sich sowohl aus statischen als auch aus dynamischen Einzelklängen, die als Einheit empfunden werden sollen, zusammensetzen.
Verbreitet ist die Meinung, dass bei einer musikalischen Interpretation die Lage des Blattes generell gleichgültig sein, dass das Blatt sozusagen je nach Belieben gedreht und gewendet werden kann. Das entspricht keineswegs immer den Vorstellungen des Schöpfers, weil dadurch die Spannungsverhältnisse, die durch das Format des Blattes mitbestimmt werden, nicht stimmig bleiben. Die Instrumentation ist bei den meisten Musikalischen Grafiken freigestellt, um einerseits eine reichhaltige Klangfärbung zu ermöglichen und andererseits die Entwicklung neuer Klangerzeuger anzuregen beziehungsweise die umfassende Nutzung der vorhandenen.